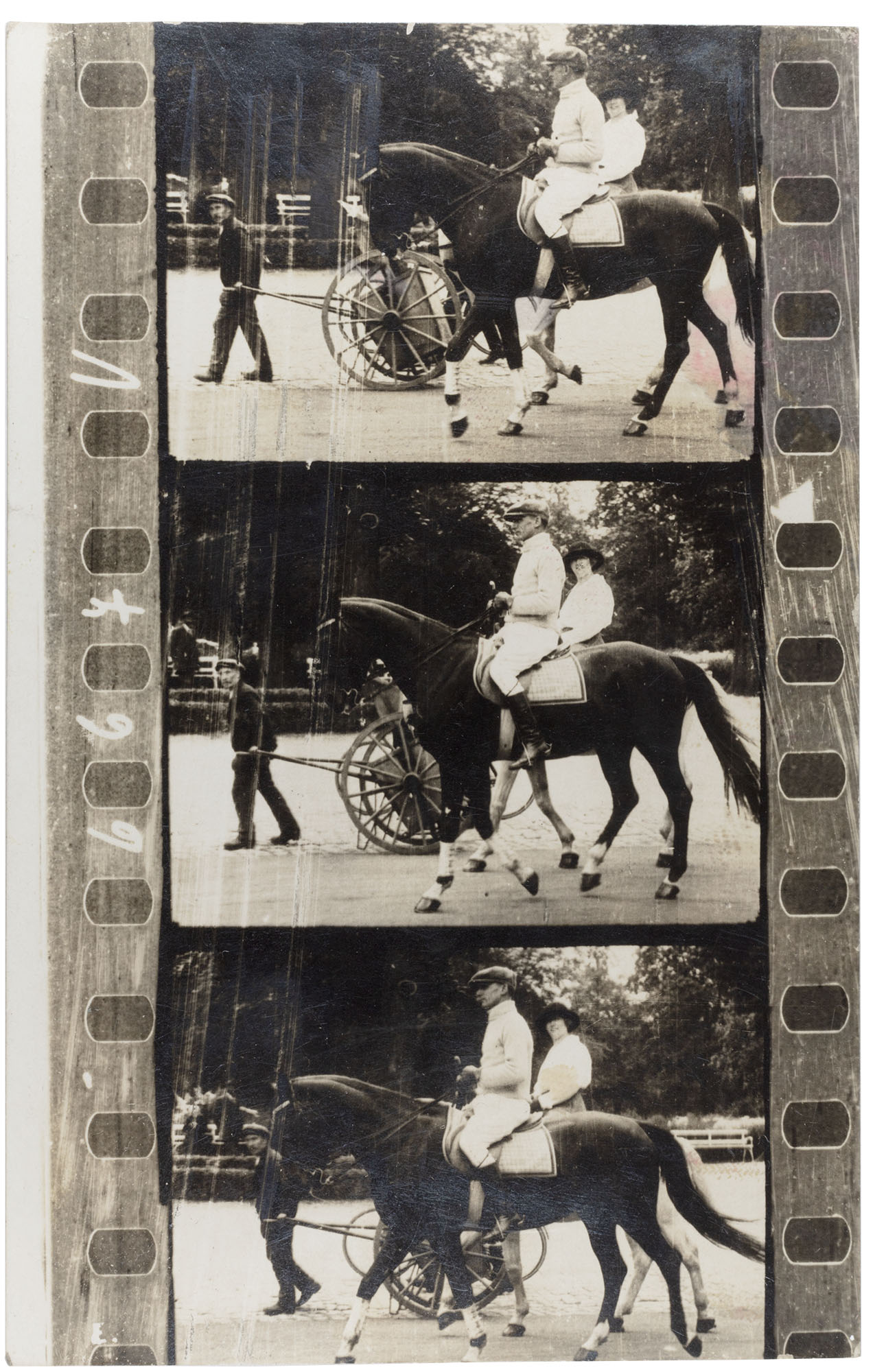„Die
Mode des Photoüberfalls"
So titelte Hubert Miketta, Chefredakteur der Revue des
Monats, in seiner Dezemberausgabe 1927 – und beschrieb damit
eine neue „Seuche“, die sich auf den Straßen Berlins
ausbreitete:
„Berlin hat
einen neuen ‚Tick‘! – Kennen Sie schon die neueste
Modekrankheit von Berlin? Nein? Also, dann hören Sie zu,
falls es Sie interessiert, Näheres über diese Seuche zu
hören. – Ahnungslos schlendert man die Leipziger Straße
entlang, sieht sich die Auslagen in den Schaufenstern an,
mustert die Vorübergehenden, stellt Betrachtungen über
hübsche Beine an – kurz, man macht das, was der Berliner
so treffend mit dem Ausdruck ‚bummeln‘ bezeichnet.
Plötzlich tritt uns ein gut aussehender, glatt rasierter
junger Mann in einem flott konfektionierten Anzug in den
Weg und schleudert einige geheimnisvolle Worte in unsre
mehr oder minder geistreichen Gedankengänge. Diese Worte
lauten: ‚Sie sind soeben gefilmt worden!‘ Gleichzeitig
wird uns ein nummerierter Zettel in die Hand gedrückt, der
nähere Aufklärung erteilt.“


AKICE – Steinborn’s Film-Geh-Aufnahmen
Das zugrunde
liegende Verfahren für sogenannte Film-Geh-Aufnahmen (auch
bekannt als Geh-Film-Aufnahmen) wurde von dem weitgehend
unbekannten Fototüftler Gerhard Steinborn aus Bad Neuenahr
entwickelt. Seine Technik scheint von zahlreichen
Straßenfotografen – vermutlich in Lizenz – übernommen
worden zu sein.
In Bad Neuenahr betrieb Steinborn das „Photohaus Gerhard
Steinborn“ in der Poststraße 12. Zudem ist er als
Geschäftsführer der „Photolux Gesellschaft für
kaufmännische Großhandelsgeschäfte der photographischen
Branche, insbesondere des Vertriebs von
Filmaufnahmeapparaten“ eingetragen – ein Unternehmen, das
im Jahr 1931 wieder aufgelöst wurde.
Es finden sich nur spärliche Hinweise auf sein Wirken,
darunter eine englische Patentschrift für eine Fotokabine.
Ein spanisches Patent aus dem Jahr 1927, das auf seinen
Namen ausgestellt ist, dürfte sich auf die Film-Geh-Aufnahmen
beziehen:
„Un procedimiento para la producción de series positivas
fotográficas de objetos movibles. – Eine Methode zur
Herstellung von fotografischen Positivserien beweglicher
Objekte."
Ein deutsches Patent ist hingegen nicht nachweisbar.
Naheliegend ist, dass Steinborns System auf ausgedienten
Stummfilmkameras basierte, die mithilfe einer Handkurbel
drei aufeinanderfolgende Belichtungen ermöglichten. Die
entstandenen Aufnahmen wurden anschließend im
Postkartenformat ausbelichtet.
Ein interessantes Zeugnis findet sich in einer
Kleinanzeige vom 29. Juni 1927, die einen praxisbereiten
Gerätebestand anpreist und Einblick in die damals
benötigte Ausstattung gibt:
„Fotograf!
Umständehalber komplette Einrichtung für
Filmgehaufnahmen preiswert abzugeben.
Filmaufnahme-Apparat, Filmstativ,
Spezialvergrößerungsapparat, Dunkelkammereinrichtung usw.
Dunkelkammer kann billig gemietet werden.
Lohnender
Verdienst!“

Der Artikel von Hubert Miketta
führt weiter aus:
„Nicht
jeder wird gefilmt – man
muß schon durch irgendwelche
äußeren Merkmale die Sympathie
des Kameramannes erregen. Also
immerhin, man ist durch seine
Persönlichkeit aufgefallen und
fühlt sich geschmeichelt.
Außerdem kostet der Scherz nur
eine Mark, falls man Wert auf
das Ergebnis der Aufnahme legt.
– Wenn man dann am folgenden
Tage den Filmstreifen, der aus
drei Bewegungsbildern besteht,
abholt, ist man zunächst, offen
gesagt, ein wenig bestürzt.
Wenigstens mir ging es so. Bin
ich wirklich dieser durchaus
salopp wirkende, mit flatternden
Hosenbeinen und auseinander
wehendem Mantel dahineilende
Straßenpassant? Nun wird mir
plötzlich der Unterschied klar
zwischen einer im Atelier
hergestellten Aufnahme, für die
wir uns extra zurecht machen,
und einer Aufnahme, die jählings
von uns gemacht wurde, ohne daß
wir es wußten. Gewissermaßen ein
Bild ohne die Maske der
photographischen Konvention. So
sehen wir wirklich aus, denn das
Objektiv lügt nicht. Ein solches
Bild charakterisiert uns besser,
als man es in Worten ausdrücken
könnte.“

Doch nicht jeder "Photoüberfall"
blieb ohne Konsequenzen, wie Miketta in seinem
zeitgenössischen Artikel weiter berichtet:
„Es braucht ja nicht jedem gleich so zu gehen, wie jenem
rheinischen Großkaufmann, der kürzlich mit seiner sehr
entzückenden Freundin eine Bummelreise nach Berlin
unternahm und hier gefilmt wurde. Einige Tage später kam
seine weniger entzückende Gattin gleichfalls nach Berlin
und wurde an derselbe Ecke gleichfalls gefilmt. – Als sie
ihre Bilder abholte, sah sie unter dem Stapel von Photos
plötzlich auch ihren Gatten abgebildet an der Seite seines
blonden Vergnügens. Ihr hatte er erzählt, daß er auf einer
mehrtägigen Aufsichtsratssitzung in Düsseldorf wäre. –
Tableau! Nun, so schlimm braucht es nicht immer gleich zu
kommen. Ein anderer älterer Herr stellte bei einer
Begegnung auf der Straße seine sehr viel jüngere Freundin
einfach als „bisher verheimlichte Tochter“
vor.“

Fotografie als Zeitdokument:
Obwohl diese Aufnahmen aus rein kommerziellen Motiven
entstanden, zählen sie zu den frühesten Formen
dokumentarischer Straßenfotografie. Trotz teils mäßiger
Bildqualität gewähren sie einen authentischen Einblick in
das urbane Straßenleben auf den Flaniermeilen der Großstädte
und Kurorte der 1920er Jahre – denn genau dort
positionierten sich die Fotografen bevorzugt.
Über diese "Schnellfotografen",
ist nur wenig bekannt. In den Krisenzeiten der Weimarer
Republik suchten sie nach Einnahmequellen, um ihren
Lebensunterhalt zu sichern.
Ihr sozialer
Status war vermutlich prekär: Mit einfachsten Mitteln
ausgestattet, bewegten sie sich wohl eher am Rande der
Gesellschaft.
Beliebt bei der Obrigkeit war ihr Geschäft eher nicht – wie
zeitgenössische Zeitungen in mehreren Städten berichteten.
So schrieb etwa die Neue Mannheimer Zeitung am
11.06.1927:
„Geh-Film-Aufnahmen nur noch mit polizeilicher
Genehmigung -
Als vor einigen Wochen die ersten Straßenfotografen
auftauchten, um das Publikum mit den neuen
Geh-Film-Aufnahmen zu überraschen, stand man dieser
Neuerung im Allgemeinen sympathisch gegenüber. Inzwischen
hat sich aber aus den ursprünglich nur vereinzelt
aufgetretenen Straßenfotografen ein wahres Gewerbe
gebildet. An allen Ecken und Plätzen sind heute diese
Kurbelkästen aufgestellt und zu einer Plage für das
Publikum geworden.
Der Polizeipräsident von Frankfurt hat
nunmehr angeordnet, dass das gewerbsmäßige Fotografieren
auf allen Straßen nur noch mit polizeilicher Genehmigung
zulässig ist. Jede Belästigung des Publikums, die sich aus
dem Fordern von Anzahlungen, dem Aufstellen der Apparate
sowie dem Anhalten von Fußgängern usw. ergibt, ist
untersagt.
Unlautere Fotografen gab es ebenfalls. Das Volksblatt für
Harburg, Wilhelmsburg und Umgegend berichtete in der
Ausgabe vom 22.08.1927 :
„Blinddreher - Der 20-jährige Kaufmann Karl Rigge aus
Westfalen machte in den letzten Wochen in verschiedenen
Städten in und außerhalb Bayerns Geh-Film-Aufnahmen und
ließ sich Anzahlungen von 1 bis 2 Mark geben. In
Wirklichkeit drehte er blind, denn sein Kurbelkasten war
leer. In Würzburg gelang es nunmehr, den Schwindler
dingfest zu machen."

Fotografie als Straßenkunst:
In drei
aufeinanderfolgenden Bildern schreitet ein gut
gekleideter Mann über eine breite Straße – ein
stilvoller Auftritt im Großstadtleben der 1920er-Jahre.
Der Fotograf bleibt im Hintergrund, doch sein Blick ist
geschult: Es scheint, als habe er die bewusste
Selbstinszenierung des Mannes erkannt – vielleicht in
der Hoffnung, den elegant auftretenden Passanten als
Käufer der Aufnahme zu gewinnen.
Die Szene
erinnert an einen kurzen Filmclip – ein Eindruck, der hier
durch die sichtbare Filmperforation am Rand des
Bildstreifens noch besonders verstärkt wird.

Authentizität trotz Inszenierung:
Zwei junge,
elegant gekleidete Frauen flanieren mit einem Herrn
durch die Straße – möglicherweise vorgewarnt vom
Fotografen –, versuchen jedoch, sich ungezwungen zu
geben und in Bewegung zu bleiben. Eine Frau im
Hintergrund dreht sich neugierig um und verweist so auf
die öffentliche Aufmerksamkeit, die solche Fotoaktionen
hervorriefen.
Viele dieser Aufnahmen zeigen inszenierte oder
halb-inszenierte Szenen: Passanten bemerken den
Fotografen und reagieren sichtbar, andere scheinen ihn
gar nicht zu bemerken. Trotz oder gerade wegen dieser
Mischung aus bewusster Pose und spontaner Bewegung
vermitteln die Bilder authentische Eindrücke des urbanen
Lebensgefühls jener Zeit.

Kommerzielle Motivation:
Ein stilvolles
Paar überquert die Straße und blickt direkt in die
Kamera – ihre bewusste Pose steht im Kontrast zum
unbeachteten Alltagsgeschehen im Hintergrund, etwa einer
vorbeifahrenden Straßenbahn. Obwohl die Szene wie eine
spontane Momentaufnahme wirkt, verrät sie eine starke
visuelle Komposition – das Ergebnis von Erfahrung und
Instinkt des Fotografen, der Bilder erschuf, die sich
verkaufen ließen. Aus kommerziellen Interessen
entstanden, zielten diese Aufnahmen darauf ab, Passanten
als Kunden zu gewinnen. Sie markieren einen Wendepunkt
in der Fotografiegeschichte: Die Kamera verlässt das
Atelier, geht auf die Straße – hin zur Bewegung, zum
Zufälligen. Damit werden diese Bilder zu frühen
Vorläufern der modernen Straßenfotografie.



Die Straße wird zur
Bühne:
Männer und Frauen in
stilvoller Kleidung bewegen sich frontal auf die Kamera zu,
ihre Haltung wirkt kontrolliert und selbstbewusst. Sie
inszenieren sich für den Gang im öffentlichen Raum, den sie
als Schauraum nutzen. Der Fotograf erkennt diesen Moment der
Selbstpräsentation – ein Spiel zwischen Alltagsbewegung und
fotografischer Pose – und zugleich eine Verkaufsgelegenheit:
Die Porträtierten sollen sich im Bild wiedererkennen und es
ihm anschließend abkaufen.

Bildästhetik des Zufalls:
Ein modisch gekleideter
Mann und eine Frau schreiten frontal auf die Kamera zu – die
Frau blickt direkt in die Linse, möglicherweise hat sie den
Fotografen bemerkt. Trotz dieser bewussten Reaktion wirkt die
Szene in ihrer Gesamtheit authentisch, als Momentaufnahme
urbanen Alltags. Diese Fotografie steht exemplarisch für eine
neue fotografische Praxis der Zwischenkriegszeit: Der
technologische Fortschritt – insbesondere mobile Kameras, die
schnelle Aufnahmen im öffentlichen Raum ermöglichten –
veränderte die Bedingungen fotografischer Bildproduktion
grundlegend. Zwar war die Aufnahme hier wieder kommerziell
motiviert, mit dem Ziel, sie den Porträtierten zu verkaufen,
doch dokumentiert sie weit mehr: Kleidung, Körperhaltung,
Bewegung – all das macht sie zu einem Zeitdokument
.

Vorläufer der modernen Straßenfotografie:
Drei elegant gekleidete
Personen flanieren über einen großstädtischen Boulevard,
während im Hintergrund eine Straßenbahn mit der Aufschrift
„Städtische“ auf die Berliner Verkehrsbetriebe verweist.
Kleidung, Haltung und Auftreten wirken bewusst gewählt – wie
eine kleine Szene auf der Bühne des Großstadtlebens.
Der Fotograf bleibt im Verborgenen, scheint aber den Moment
der Selbstinszenierung gezielt eingefangen zu haben – nicht
zuletzt, weil die wohlhabend wirkende Gruppe potenzielle
Kundschaft für den Bildverkauf darstellte.
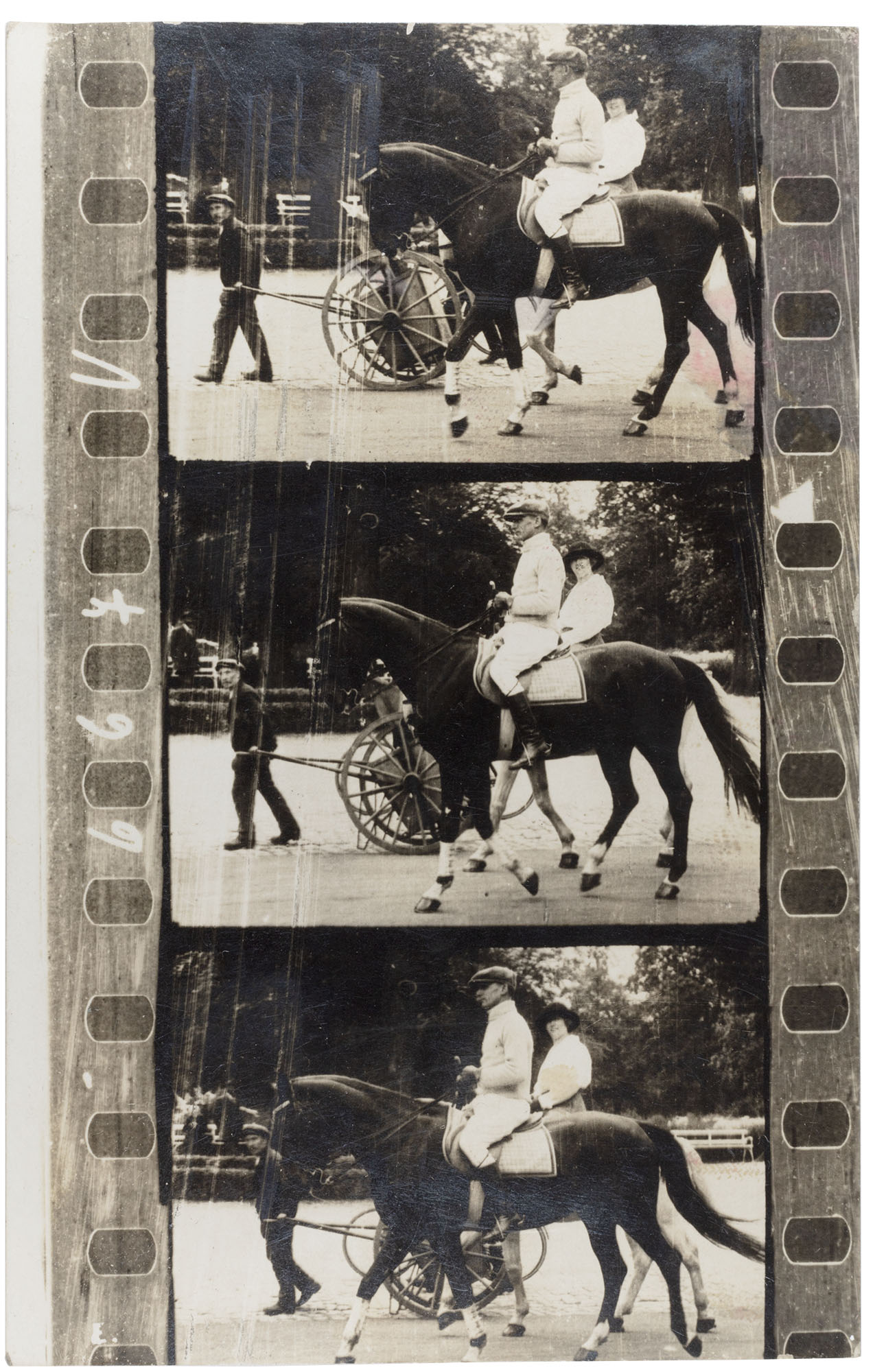
Dokumentation sozialer Realität:
Ein wohlhabendes Paar auf einem Pferd
wird fotografiert. Im Hintergrund erscheint zufällig ein
Arbeiter mit Handkarren – der Kontrast zwischen sozialem
Status wird unbeabsichtigt sichtbar und es entsteht so ein Bild sozialer
Realität, das gesellschaftliche Unterschiede sichtbar macht
– etwas, das der Fotograf vermutlich weder geplant noch
bewusst wahrgenommen hat.

Einfluss des Films:
Eine verwischte Aufnahme eines fahrenden
Autos erinnert in Dynamik und Rahmung an das Kino – eine
visuelle Annäherung an die moderne, bewegte Bildkultur.
Dynamik wie im Film: Die Bildsequenz zeigt ein vorbeifahrendes
Auto – die Bewegung ist verwischt, die Filmperforation
sichtbar, was den Eindruck eines laufenden Films verstärkt. So
verweist das Bild nicht nur inhaltlich, sondern auch formal
auf den Einfluss des Kinos auf die Fotografie jener Zeit.
Gleichzeitig spiegelt es das urbane Leben der Weimarer
Republik.


Gebrauchsweisen im
Kontext der Postkartenkultur:
Zwei elegant gekleidete Frauen flanieren 1932
durch Bad Pyrmont und posieren für die Kamera, während ein
weiteres Duo in sommerlicher Kleidung spontan auf den
Fotografen reagiert – beobachtet von einem Mann und
mehreren Kindern im Hintergrund, die neugierig das
Geschehen verfolgen. Diese sogenannten Film-Geh-Aufnahmen
wurden im damals weit verbreiteten Postkartenformat
entwickelt und fanden vielfältige Verwendung: Sie wurden
als persönliche Erinnerungsstücke ins Familienalbum
geklebt, als Gruß versendet – teils mit direktem Bezug auf
das Bild, etwa mit Kommentaren wie „beim Filmoperateur“
oder „ist dieses nicht ein schöner Film?“ – oder auch
zerschnitten, um einzelne Porträts oder Szenen
hervorzuheben.


Technische Mängel als ästhetisches Merkmal:
Zwei Frauen haben beim
Schaufensterbummel den Fotografen
bemerkt und reagieren freudig-unsicher –
ein spontaner Moment im öffentlichen
Raum. Die oft mäßige
Bildqualität solcher Aufnahmen war kein
Zufall, sondern Ausdruck der prekären
Arbeitsbedingungen der Fotografen: Sie
arbeiteten mit einfacher, teils
überholter Ausrüstung, entwickelten ihre
Fotos improvisiert und mussten auf der
Straße schnell reagieren.Gerade diese
technischen Unzulänglichkeiten –
Unschärfen, Kontraste, Bildfehler –
verleihen den Bildern eine besondere
Unmittelbarkeit und machen sie zu
authentischen Zeitdokumenten.

Heute erscheinen diese Aufnahmen in einem neuen Licht: nicht
als nostalgische Kuriosa, sondern als rohe, frühe Dokumente
einer visuellen Moderne – zugleich wertvolle
sozialdokumentarische Quellen des urbanen Alltags. Mit den
Film-Geh-Aufnahmen etabliert sich eine Bildsprache, die in
Selfies und der zeitgenössischen Straßenfotografie
weiterwirkt. Gerade ihre Unvollkommenheit, Serienhaftigkeit
und spontane Ästhetik machen sie heute überraschend
zeitgemäß.
Mehr Bildbeispiele
gibt es in diesem Magazin als PDF download: